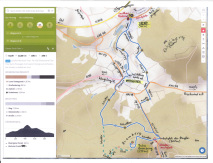Der Bramberg - eine überaus lohnende Aussichtswarte
Nachfolgende Infos, Ausblicksbeschreibung und Geschichtliches von Uwe Rädlein, Gastwirt, Kulturwart und >Naturparkbotschafter
Erste Baumrodung brachte freie Sicht
Nach der im Sommer 2008 erstmalig innerhalb und im Umfeld der Ruine durchgeführten, recht umfangreichen Baumfällungsmaßnahme - es wurden die hochgewachsenen, mächtigen Linden und Buchen entfernt - hat man nun einen größtenteils freien Blick über das vor 200 Millionen Jahren aus dem damaligen Keupermeer entstandene kleine Mittelgebirge der Haßberge. Ebenso kann man seitdem auch weit darüber hinaus, bis in das angrenzende Hinterland Ausschau halten.
Aussichtsplattform
Seit dann im April 2022 eine mit stählerner Wendeltreppe erreichbare Aussichtsplattform im Torturm der Burgruine
feierlich eröffnet wurde (zuvor hatte man erneut Baumfällungen und Freischnittarbeiten um die Ruine unternommen), haben sich die Aussichtsmöglichkeiten noch einmal erheblich verbessert. Neben der
regionalen Presse berichteten auch die Fernsehsender des Bayerischen Rundfunks und von TV-Touring von der Eröffnungsfeier. Und so ergab es sich dann, dass die mitwirkenden Blasmusiker der
„Schlossberger Hohnhausen“ zu einem ganz besonderen Fernsehauftritt auf „ihrem Schlossberg“ kamen. Als musikalische Bühne in luftiger Höhe diente die neu errichtete Plattform.
Die gesamten Baukosten der Aussichtsanlage beliefen sich auf 130.000 Euro. Der Entwurf stammt von der Planungsabteilung der Bayerischen Staatsforsten. Die Herstellung unternahmen die beiden
regionalen, im Naturpark ansässigen Firmen Stahlbau Kirchner aus Breitbrunn und Kirchner-Bau aus Sulzbach. Finanziert wurde dieses sogenannte Leuchtturm-Projekt zu 90% vom Freistaat Bayern und zu 10%
von den Bayerischen Staatsforsten selbst.
Talblicke
Beim Herabschauen vom Bramberg, welcher von den Einheimischen einhellig Schlossberg genannt wird, fallen dem Betrachter in der ihm zu Füßen liegenden typisch welligen Hügellandschaft der Haßberge die kleinen Ortschaften ins Auge. Malerisch schön liegen diese zwischen Wiesen und Felder in die Tallagen eingebettet.
Auf hohem Throne stehe ich, die Heimat mir zu Füßen bunt,
der Kuckuck schallt, mein Herze lacht, ich geb's Euch freudig kund.
(Uwe Rädein, "Schlossberg" im Mai 2020)
Ausblicke
Tipp: Für die nahen Blicke über die Haßberge und zu den unmittelbar daran angrenzenden Regionen reicht dem Betrachter schlicht sein gutes Auge. Für die weiter entfernten Ausblicke empfiehlt es sich, ein gutes Fernglas, nachfolgenden mit „[F]“ gekennzeichnet, zur Hand zu nehmen. Beste und absolut ungetrübte Fernsicht ist für diese Fernblicke jedoch Voraussetzung!
Die insgesamt fünf installierten Panoramatafeln wurden vom Naturpark Hassberge ausgearbeitet und errichtet.
Ausblick von Nordwesten bis Nordosten
Nach Nordwesten blickend, erstreckt sich bis an den südlichen Rand des Grabfeldgaus angrenzend, der großflächig bewaldete Höhenzug des
sogenannten „Großen Haßbergs“. Höchster Punkt ist dort die 13,4 Kilometer entfernte, und mit Sendemasten bestückte Nassacher Höhe - sie ist mit mittlerweile exakt vermessenen 512,2 Metern zugleich
der höchste natürliche Punkt des kleinen Mittelgebirges namens Haßberge. Von der unmittelbar am historischen Rennweg gelegen Nassacher Höhe aus, lässt sich bei scharfem Auge knapp rechts davor auf
der Eichelsdorfer Schwedenschanze (487 m, 11 km) der holzverschalte Aussichtsturm ganz unscheinbar zwischen den Baumwipfeln entdecken.
Blickt man über den Großen Haßberg ins Hinterland hinaus, so erhebt sich von links her die knapp über 900 Meter hohe Rhön mit ihren vielen rundlich geformten Basaltbergen.
Von der im Jahre 2022 in der Burgruine installierten Aussichtsplattform aus, erkennt man ein Stück links neben den eigentlichen Rhönriesen in 65 Kilometer Entfernung den wegen seiner isolierten Lage
recht auffälligen Dreistelz [F], nahe Oberleichtersbach. Der mit einem kleinen
Aussichtsturm bestückte Berg ist mit 660 Metern die höchste Erhebung der Brückenauer Kuppenrhön, die im Übergangsbereich des Spessarts zur Rhön liegt. Nach rechts schwenkend beginnt der eigentliche
Gebirgsstock der Rhön mit den sogenannten „Schwarzen Bergen“. Als erstes fällt am linken Rand des Rhön-Ensembles die 55 Kilometer entfernte Platzer Kuppe (737 m) auf. Die kugelförmige Anhöhe ist
gemeinsamer Hausberg der Ortschaften Platz und Geroda. Diese beiden Dörfer liegen nahe der Autobahnanschlussstelle „Bad Brückenau/Wildflecken“, über welche die Bundesstraße 286 Anbindung an die
Bundesautobahn 7 findet. Rechts neben der Platzer Kuppe befindet sich der Erlenberg (826 m) und dann folgt ein breiter Rücken, deren höchster Punkt dort nennt sich Totnansberg (841 m), er ist mit
einem kleinen Sendemast [F] bestückt. Über den anschließend zu erkennenden Pass
führt die Kreisstraße KG 45, sie verbindet die Orte Gefäll, zum Markt Burkardroth gehörend, mit Oberbach, das nördlich hinter dem Pass im Sinntal liegt. Rechts des Passes baut sich der 56 Kilometer
entfernte, 832 Meter hohe Feuerberg auf. Er markiert das östliche Ende der „Schwarzen Berge“. Die Kissinger Hütte, welche sich ganz oben auf dem freien Plateau des Feuerbergs befindet, ist ein
beliebter Ausflugsort. In gleicher Richtung, aber 300 Höhenmeter tiefer liegend, schmiegt sich in 53 Kilometern Entfernung und bei einer Seehöhe von 534 Metern mit dem Ort Langenleiten
[F] eines der höchstgelegenen Rhöndörfer an den Südosthang des Feuerbergs.
Weiter rechts geht der Blick nun zum Guckaspass, über diesen gelangt man auf der Staatstraße 2267 von Langenleiten nordwärts hinüber zum Garnisonsstandort Wildflecken, wiederum im Sinntal gelegen.
Recht des Passes tut in 55 Kilometer Entfernung breit und erhaben der mächtige Kreuzberg (928 m) auf. Das dortige Franziskanerkloster und das darin gebraute süffige Klosterbräu-Bier locken
alljährlich viele Besucher und Wallfahrer auf diesen höchsten der insgesamt drei heiligen Berge Frankens. Auch in der kalten Jahreszeit kommen viele zum Kreuzberg, um dort dem alpinen sowie den
nordischen Skisport zu frönen. Bei klarer Sicht erkennt man den hohen Funkmast des Senders Kreuzberg [F]
- als Peilung zum Mast hin, kann hier der Blick knapp links vorbei am Kuppeldach des 19 Kilometer entfernten Schlosses Craheim, bei Wetzhausen, angenommen
werden.
[Nochmal zurück zum Guckapass: Knapp rechts des Passes ist dahinterliegend, in 64 Kilometer Entfernung, der bayerisch-hessische Grenzberg Dammersfeldkuppe, welcher mit 928 Metern die exakt gleiche
Höhe wie der Kreuzberg aufweist, zu erkennen.]
Unmittelbar rechts neben dem Kreuzberg ist der ebenso mit Skiliften bestückte Arnsberg (843 m) als kleine Gipfelspitze zu erkennen. Dann folgt der bereits auf hessischem Boden aufragende Reesberg
(851 m). Im rechten Auslauf dieses Berges ist deutlich markant eine passartige Eintiefung, die Rhöner Schwedenschanze (715 m), zu erkennen. Rechts neben diesem bayerisch-hessischen Grenzpass, über
welchen die Bundesstraße 279 von Bischofsheim hinüber nach Gersfeld führt, ragt in 60 Kilometer Entfernung ein eng beieinanderstehendes Bergdrio auf. Die klangvollen Namen der Anhöhen sind der Reihe
nach Teufelsberg (844 m), Himmeldunkberg (888 m) und Hohe Hölle (894 m).
Nun verdeckt der Große Haßberg kurz die Sicht zur Rhön, doch schon unmittelbar rechts hinter dem nahen Aussichtsturm auf der Eichelsdorfer Schwedenschanze (497 m) zeichnet sich am Horizont der Heidelstein (926 m, 60 km) mit seinem Sendemast [F] ab. Der Heidelstein ist der höchste Punkt der sich weit nach rechts fortsetzenden sogenannten „Langen Rhön“. Entlang dieses Höhenzuges verläuft die im winterlichen Verkehrsfunk oftmals genannte Hochrhönstraße (Staatsstraße 2288), welche Bischofsheim i.d.R. mit Fladungen verbindet.
Schwenkt man seinen Blick nun weiter nach rechts, erkennt man 13,3 Kilometer entfernt das Haßbergdorf Bundorf. Knapp dahinter ist rechts neben einer kleinen Eintiefung in der Waldsilhouette der Kleine Haßberg (426 m, 15 km) zu erkennen. Weiter nach rechts blickend, aber noch links vom vier Kilometer entfernten Fitzendorf, fällt im gut 35 km Entfernung der breite, weißfarbene Aussichtsturm [F] von Rappershausen, unmittelbar an der bayerisch-thüringischen Grenze gelegen, ins Auge. Exakt auf dieser Blicklinie lieg das nicht einsehbare Bad Königshofen (25 km), einem der Hauptorte des Grabfeldgaus.
In der Nähe fallen die Blicke der Reihe nach auf benachbarte Haßberggipfel, diese sind der Büchelberg (467 m; 6,3 km), der Rauhberg (412 m; 4 km) und der Zeilberg (463 m; 10 km) incl. des dort in Betrieb befindlichen großen Basaltsteinbruchs. Dann, zum Greifen nah, erhebt sich in nur 2,3 Kilometer Gipfelentfernung der Eichelberg (427 m), auf welchem bis in die 1960er Jahre hinein Burgpreppacher Sandstein abgebaut wurde (dieser wird übrigens auf dem vorher genannten Rauhberg noch heute gebrochen). Der Eichelberg ist der Hausberg der drei Kilometer entfernt zu erkennenden Ortschaft Ibind, welche unmittelbar links des Berges im Heimbachtal liegt. Der Blick zu der hinter Ibind, in 6,7 Kilometer Entfernung liegenden Ortschaft Ditterswind, zeigt exakt die Nordrichtung an. Rechs von Ditterswind erkennt man das Dorf Gresselgrund. In nur 1,5 Kilometer Entfernung und knapp vor der nördlichen Blickrichtung liegt dem Betrachter das Dorf Hohnhausen zu Füßen, es ist die dem Bramberg am nächsten gelegene Ansiedelung. Der untere Hangaufschwung von Hohnhausen zum Bramberg hin, trägt die Flurbezeichnung Schlossrangen. Das erklärt auch den volksmündlichen Namen Schlossberg, wie die Einheimischen liebevoll, aber auch stolz ihren Berg nennen.
Über die vorher erwähnten Haßberghöhen hinausblickend, erstreckt sich großflächig das Thüringer Land. Nördlich, in Blickrichtung
Rauhberg gesehen, ragen aus dem Heldburger Land, dem Übergang zum Thüringer Wald, in gut 30 Kilometer Entfernung, die beiden mächtigen Basaltkegel des Großen Gleichbergs (679 m) und knapp rechts
dahinter des Kleinen Gleichbergs (641 m) empor. Direkt links neben dem Großen Gleichberg kann man bei klarer Sicht, hinter dem Tiefpunkt des Silhouetten-Schnittpunktes von Großem Gleichberg und
Büchelberg, den Großen Inselsberg in 83 Kilometer Entfernung erkennen. Auf ihm steht eine markante Turm- und Mastanlage [F]. Mit seinen 916 Metern ist der Große Inselsberg die höchste Erhebung im Bereich zwischen Bad Salzungen und Gotha.
Weiter östlich zeichnet sich links hinter dem Zeilberg, im sogenannten „Heldburger Zipfel“, die merklich kleinere, aber dennoch recht auffällige, kegelförmige Kuppe des ehemaligen Vulkans Straufhain
(449 m, 26 km) ab. Dieser steht zwischen dem thüringischem Streufdorf und dem schon zu Oberfranken gehörenden Bad Rodach. Der Straufhain zählt genau wie unser Bramberg, der Zeilberg und die beiden
Gleichberge zu den Basaltbergen, die vor 16 Millionen Jahren während der Vulkantätigkeit der sogenannten Heldburger Gangschar entstanden sind. Und dazu gehört noch die vom Zeilberg sichtverdeckte
Veste Heldburg, die seit dem 14. Jhd. auch als „Fränkische Leuchte“ bezeichnet wird.
Knapp links vom Straufhain liegt auf dem Hauptkamm des Thüringer Waldes, in knapp 62 Kilometern Entfernung, Thüringens höchster Punkt. Es ist dies vom Bramberg aus betrachtet, der relativ unscheinbare und 983 Meter hohe Große Beerberg. Der aus erdzeitgeschichtlicher Sicht gesehen sehr alte Vulkanberg war vor über 250 Mio. Jahren tätig. Er markiert das Gebiet Suhl, Zella-Mehlis und Oberhof.
Ausblick von Nordosten bis Südosten
Aus dem Nordosten grüßen die hochthronenden Haßbergdörfer Altenstein (10 km), und von etwas weiter rechts das kleine Lichtenstein (11
km), zur Bramburg herüber. Inmitten dieser beiden Ortschaften befindet sich jeweils eine sehenswerte Burgruine. Links von Altenstein erkennt man am Horizont, auf dem Höhenzug des Thüringer Waldes,
den bei Eisfeld aufragenden Bleßberg (867 m, 46 km) [F]. Auf dem „Bleß“, wie der
Kolos im Volksmund auch kurz genannt wird, steht ein 195 Meter hoher, markanter Sendeturm [F].
Schweift man wieder gen Osten, so sind zwischen Altenstein und Rabelsdorf (welches sich rechts unterhalb von Altenstein befindet), in 56 Kilometer Entfernung und auf einer Hochebene des Frankenwaldes
gelegen, Gebäudlichkeiten des Thüringer Bergdörfchens Neuenbau [F] auf 717 Metern
Seehöhe zu erkennen. Neuenbau gehört zur Gemeinde Judenbach im Landkreis Sonneberg. Weitere vier Kilometer hinter Neuenbau liegt das nicht einsehbare bayerische Tettau im Landkreis
Kronach.
Leider ebenso keine Sicht hat man zur berühmten Veste Coburg - auch „Fränkische Krone“ genannt - sie liegt in Verlängerung des Blicks über den rechten Ortsrand Rabelsdorfs hinaus.
Die Blickrichtung mittig hinweg zwischen dem kleinen Herbelsdorf und dem auffälligen Fabrikgebäude der Fa. Valeo bei Fischbach markiert weit hinten am Horizont die höchste Erhebung des Frankenwaldes, den Döbraberg (795 m, 64,5 km) [F]. Etwa in dieser Richtung liegen die beiden nicht einsehbaren oberfränkischen Städte Lichtenfels (30 km) und Kronach (51 km).
Knapp vor der exakten Ostrichtung, fällt in gut 26 Kilometer Entfernung Schloss Banz ins Auge. Die mächtige Anlage thront anmutig über
dem Obermaintal nahe des Adam-Riese-Städtchens Staffelstein.
Gegenüber von Schloss Banz - vom Bramberg aus aber nicht einsehbar - befindet sich die von Franziskanermönchen geführte Basilika Vierzehnheiligen. Die Wallfahrtskirche wird in Punkto Besucherzuspruch
bayernweit nur noch von der Gnadenkapelle Altötting übertroffen.
Genau in östlicher Richtung, erhebt sich, gut 7 Kilometer entfernt, der Haubeberg (431 m) mit der Burgruine Raueneck. Und hinter den
beiden 14 Kilometer entfernten Eberner Windrädern, welche sich auf dem sogenannten Oberen Berg (391 m) nahe der Ortschaft Fierst drehen, zeichnet sich ganz deutlich der „Alte Staffelberg“ (529 m) mit
seinen zwei markanten Kuppen ab. Orientiert man sich noch ein wenig weiter nach rechts, scheint einem der berühmte Klausner, welcher im Lied der Franken als "heilger Veit von Staffelstein" besungen
wird, vom Staffelberg (539m) aus etwa 28 Kilometer Entfernung herüberzuwinken. Auffällig macht den Staffelberg - welcher wie der bereits oben genannte Kreuzberg, einer der drei heiligen Berge
Frankens ist - seine breite felsige Flanke. Sie wird als „Scheffelfelsen“ bezeichnet. […der Karlsruher Dichter Victor von Scheffel, der einst sein Herz an diese idyllische Obermainlandschaft, auch
„Gottesgarten“ bezeichnet, verlor, hat 1859 mit seinen sechs Gedichtversen die Grundlage zur inoffiziellen Frankenhymne „Wohlauf die Luft geht frisch und rein“ gelegt. Die melodische Vertonung dazu,
lieferte Valentin Eduard Becker dann im Jahre 1870.]
Hinter dem Staffelberg, knapp rechts seiner Mitte, erkennt man an klaren Tagen den in 87,5 Kilometer Entfernung im Fichtelgebirge aufragenden Schneeberg [F]. Mit seinen 1.051 Metern ist er der höchste Berg in ganz Franken. Im Kalten Krieg wurde das
riesige und nahezu baumfreie Gipfelplateau, mitsamt dem dortigen Granitblockmeer und einer kleinen Felsenburg, auf der das historische Aussichtstürmchen namens Backöfele steht, zum militärischen
Sperrgebiet. Ab 1951 errichten nämlich die US-Armee und ab 1961 auch die Bundeswehr ein groß angelegtes Sender- und Antennenensemble, was vorwiegend der militärischen Ausspähung des Ostens diente.
Markant ist der auffällig bauchige Fernmeldeturm, den die Bundeswehr zwischen 1963 und 67 baute. Mit dem Fernglas ist dieser gut zu erkennen. Nachdem dann 1989/90 der Eiserne Vorhang fiel, schwand
das strategische Interesse des Westens an dieser exponierten Aussichtswarte nahe der tschechischen Grenze rapide. Und so verließen am 30. Juni 1994 schließlich die letzten Soldaten den Schneeberg.
Seit 1996 hat die Öffentlichkeit nun endlich wieder freien Zugang zum Backöfele, dem „höchsten End“ Frankens.
Schweift man mit dem Fernglas ein wenig nach rechts, erkennt man in 84,5 Kilometer Entfernung mit dem bekannten Ochsenkopf [F] den nächsten Fichtelgebirgsriesen. Er ist mit einem schlanken, aber mächtigen Sendemast bestückt, welcher ebenso an klaren Tagen
mit dem Fernglas zu erkennen ist. Mit seinen 1.024 Metern ist der Ochsenkopf zugleich zweithöchster Berg Frankens.
In der Verlängerung des Blicks über die beiden nahen Dörfer Bramberg (2,2 km) und Jesserndorf (4,4 km) hinaus, erkennt man in 34 Kilometern Entfernung die gut erhaltene Giechburg [F], die auf dem 530 m hohen Schlossberg über dem Ort Scheßlitz thront.
Im Südosten ragen in der Nachbarschaft zu unserem Bramberg zwei markante Haßberggipfel auf. Es sind diese der 7 Kilometer entfernte Stachel (484 m) bei Pettstadt und rechts daneben der 13,5 Kilometer entfernte und mit einem Sender bestückte Lußberg (464 m), nahe der gleichnamigen Ortschaft.
Unmittelbar links vom Stachel erkennt man in knapp 42 Kilometer Entfernung - am nördlichen Rande der Fränkischen Schweiz gelegen - den 127 m hohen Bamberger Sendeturm [F], der auf dem Wachknock (558 m) beim Dörflein Kälberberg im Gemeindegebiet Buttenheim steht. Die unmittelbar rechts neben dem auffälligen Sender liegende, noch höhere Erhebung des Höhenzuges ist die Friesener Warte (562 m), der Blick dahin wird jedoch vom Stachel verdeckt.
Rechts des langgestreckten Lußberg fällt in 5,8 Kilometer Entfernung die flache
Pyramide namens Roter Bühl (445 m) ins Sichtfeld. Zwischen diesen beiden Haßberghöhen ins Hinterland schauend, kann man bei guter Fernsicht in 57 Kilometer Entfernung den letzten der drei heiligen
Berge Frankens, das Walberla (514m) [F] der sich östlich von Forchheim erhebt,
erkennen.
Schwenkt man weiter gen Süden, ragt hinter einer sich in der Silhouette des Haßbergwaldes deutlich abzeichnenden Mulde ein heller Industrieschlot [F] auf - oft ist sogar eine deutliche Rauchfahne zu erkennen. Der 47 Kilometer entfernte
Schlot nahe der Regnitz ist Wahrzeichen des LIAPOR-Tonwerks Hallerndorf-Pautzfeld.
Die rechts der vorgenannten Mulde sich erhebende kleine, etwa 4 Kilometer entfernte Kuppe ist namenlos. Unmittelbar rechts daneben bzw. dahinter lässt sich bei klarer Sicht der 63 Kilometer entfernt
auftuende Hetzleser Berg (549 m) [F] erkennen. Dieser mächtige Randpfeiler der
Fränkischen Alp erhebt sich östlich von Forchheim und Erlangen. Auf dem tafelbergartigen Plateau befindet sich der Sportflugplatz „Hetzleser Berg, Nürnberg“.
Die rechtsseitige Begrenzung des Regnitztales markiert der 30 Kilometer entfernte Hangaufschwung der geschichtsträchtigen Domstadt Bamberg. Die im Hang zu erahnenden Gebäudlichkeiten des Klosters Michelsberg [F] und des Bamberger Doms [F] gehören zum großen Ensemble des UNESCO-Weltkulturerbes Bamberg.
Etwas rechts des Aufschwungs ragt auf dem Altenburger Berg, welcher mit 386 Metern der höchste Punkt Bambergs ist, der schlanke Turm der Bamberger Altenburg [F] nahe der Ortschaft Wildensorg auffällig aus den Baumwipfeln heraus.
Schwenkt man etwas weiter nach rechts fällt in 4,3 Kilometer Entfernung der Sender Bühl ins Auge. Danach folgen zwei auffällige Waldhöcker, welche sich westlich des Dorfes Pettstadt abzeichnen, es sind dies die gut 7 Kilometer entfernten Haßbergkuppen Hohwart (410 m) und Lerchenberg (394 m).
Dreht man nun weiter gen Süden fallen in knapp 23 Kilometer Entfernung zwei Windräder ins Auge. Sie stehen jenseits des Maintales auf der Anhöhe namens Einarmfeld. Das linke Windrad seht in der Gemarkung Trunstadt, das rechte in der Gemarkung Trabelsdorf (bei Priesendorf).
Ein weiter, Schwenk nach rechts eröffnet den Blick zum 2,8 Kilometer entfernten und mit einem Sendermast bestückten Käsberg (476 m). Über diesen führt ein geschotterter Waldweg, der sich hier Hochstraße nennt und ein Teilabschnitt des etwa 63 Kilometer langen Rennwegs darstellt. Der Rennweg, der schon im frühen Mittelalter Teil eines wichtigen Botenweges zwischen den Städten Fulda und Bamberg war, verläuft auf dem Haßberghöhenzug in Nord-Südrichtung gesehen von Sulzfeld im Grabfeldgau bis nach Dörfleins im Maintal.
Infos und Historisches zu Berg, Burg und Ruine
Entstehung des Berges
Der markante, weithin auffallende Bramberg weist eine kegelförmige Formgebung auf. Diese entwickelte sich durch seine feuerspuckende
Tätigkeit vor 16 Millionen Jahren als Vulkan der sogenannten Heldburger Gangschar. In dieser Zeit ist das vulkantypisch kegelförmige Aussehen des erdgeschichtlich relativ jungen Basaltberges
entstanden.
Zu den Basaltbergen der Heldburger Gangschar zählen - vom Bramberg einsehbar - die beiden Gleichberge, der Staufhain und der Zeilberg. Weitere Beispielhafte Vertreter sind der Ostheimer Hügel (auch
Ölberg oder Wolfshügel genannt) und die Veste Heldburg.
Burg- bzw. Schlossruine
Aufgrund der exponierten Lage eignete sich der Hochpunkt dieser aussichtsreichen Bergkuppe vortrefflich als Standort eines mittelalterlichen Herrschaftssitzes. Man geht davon aus, dass dieser im 10. Jhd. zum Schutze der zwischen Bamberg und Fulda auf dem Haßbergkamm verlaufenden Handelsstraße, dem Rennweg, auf Befehl König Heinrichs I. errichtet wurde. Heinrich war von 919 bis zu seinem Tod im Jahre 936 König des Ostfrankenreiches. Man betitelt ihn oft als den ersten "König des Deutschen Reiches". Im Jahre 1108 wurden die beiden Brüder Stephan und Hermann als Bramberger Ritter des Hochstifts Bamberg erstmals urkundlich erwähnt. Dann 1168 befahl Kaiser Friedrich I. „Barbarossa“, wegen des andauernden aufständischen Verhaltens der Bramberger gegenüber der Würzburgischen Kirche, jedoch das Schleifen der Burg per kaiserlichem Dekrets. Um 1250 ließ der Würzburger Bischof die Burg, diesmal als einen Würzburger Amtssitz, wiederaufbauen. Während des Bauernkrieges im Jahre 1525 wurde die Bramburg vom damaligen Amtmann Erhart von Wichsenstein, aus Angst vor einer vom Maintal aus heranziehenden Bauernhorde, fluchtartig verlassen. Die Aufständischen nahmen die Gemäuer kampflos ein und steckten die Burg nach 1168 wohl ein zweites Mal in Brand.
Entgegen der lange vorherrschenden Annahme, dass die Bramburg seit den Bauernaufständen zerstört und nicht mehr bewohnt war, fand der langjährige Kreisheimatpfleger Günter Lipp heraus, dass die eigentliche, die endgültige Zerstörung erst 28 Jahre später geschah. Das Ende der Bramburg geht nämlich auf das Konto des Markgrafen Albrecht II. "Alcibiades" von Brandenburg-Kulmbach (1522-1557), welcher an etlichen Fehden und Kriegen beteiligt war, bzw. diese oftmals auch selbst austrug. Der Fürstenaufstand und die Markgrafenkriege fallen in diese Epoche. Nach dem Schmalkaldischen Krieg (1546-47), hier war der protestantische Albrecht sogar unter dem katholischen Kaiser Karl V. Söldner und Reiterführer, belohnte ihn der Kaiser mit Amt und Schloss Königsberg. In der Folgezeit bekämpfte Albrecht mit seinen Soldaten vor allem auch die katholischen Bischöfe von Bamberg und Würzburg sowie unter anderem auch die Reichsstädte Nürnberg und Schweinfurt. Albrecht wütete vielerorts verheerend und richtete zumeist großen Schaden an, so war sein Heerhaufen eben auch im Baunachtal kriegerisch zugange gewesen, dabei wurde dann im April 1553 auch die bischöfliche Bramburg eingenommen. Der als "wilder Markgraf" bezeichnete Albrecht II. ließ die Burg so arg verwüsten, dass sie danach nicht mehr wiederaufgebaut wurde und so also seitdem Ruine blieb. Die bis zu der vorher genannten Zerstörung auf dem Bramberg ansässige bischöfliche Amtsstelle Bramburg wurde dann 1560 auf die ebenso bischöfliche Burg Rauheneck, die auf dem benachbarten Haubeberg thront, verlagert. Dort fungierte dann das würzburgische Doppelamt Bramberg-Rauheneck noch bis 1685, danach war diese Stelle in der Amtsstadt Ebern angesiedelt. Rauheneck wurde ab da dem Verfall Preis gegeben. Die letzten Bewohner verließen Rauheneck im Jahre 1720.
Der ehemalige Jesserndorfer Pfarrer Wilhelm Korb, der ab 1777 die Kirche in der Ortschaft Bramberg errichten ließ, nutzte die Ruine als Steinbruch. Vor allem die Türme wurden abgebrochen. Die dem Berg herunter gerollten Steine barg man sodann und fuhr sie zur Vermauerung an die Kirchenbaustelle in das Dorf. So steckt heute ein Teil der Burg in den Mauern der Bramberger Wendelinuskirche. Günter Lipp bemerkt dazu treffend: "Da ist er gut aufgehoben!"
Seit den 1920er Jahren wurden knapp unterhalb der Ruine - an der Nord- und an der Südflanke des Brambergs - zwei Basaltsteinbrüche betrieben. Nach dem II. Weltkrieg wurde das gewonnene Material z.T. auch für Reparationsleistungen, die an die Siegermächte geliefert wurden, verwendet. Doch als der fortschreitende Gesteinsabbau die Standsicherheit der noch stehenden Burgenreste gefährdete, wurde 1955 der Abbau eingestellt. Die Bayerische Forstverwaltung kümmert sich seitdem um die Sicherung der Ruine. Bis zur Forstreform im Jahre 2005 war das Forstamt Ebern hierfür zuständig und seitdem dann der Forstbetrieb Bad Königshofen.
Namensgebung
Einer naheliegenden Auslegung nach, leitet sich der Name des Berges folgendermaßen ab: Der mittelhochdeutsche Ausdruck "Bram" ist gleichbedeutend dem Wort "Dorn". Da die damaligen Burgherren dem Würzburger Bischof stets ein Dorn im Auge waren, kam es zur Bezeichnung Bramberg und die Besitzer wurden folglich als die Edelfreien zu Bramberg betitelt.
Ausblicksbeschreibung und Infos
Tipp: Ausdrucken und auf den Bramberg zur Orientierung mitnehmen!
Bramberg-Ausblicke_10-2024.pdf
PDF-Dokument [435.1 KB]
Wandervorschlag - Rundweg
Herrliche Rundwanderung (10 km) ab Ibind zum nahe
gelegenen, Basaltkegel des markanten Bramberg (494 m), incl.
der auf dem Gipfel thronenden Ruine Bramburg (sehr lohnende Aussicht!).
Anschließend geht's auf einem anderen Weg wieder zurück nach Ibind.
Hinweis für den Rückweg:
Bei trockenem Wetter empfiehlt es sich, ab kurz nach der Ruine die in der nachstehenden downloadbaren Wanderkarte blau gestrichelte Alternativroute zu wählen.
Tipp: Ausdrucken und auf den Bramberg zur Orientierung mitnehmen!
Wanderkarte_Bramburg.pdf
PDF-Dokument [4.3 MB]